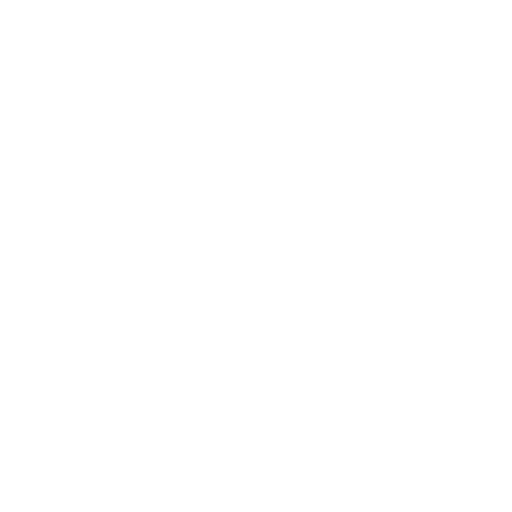Inhalt
Thema | Sportpsychiatrie
"Kriegen Sie das schnell wieder weg?"
Seit der Beendigung ihrer eigenen Leistungssportkarriere als Kanutin und dem Studium in Klinischer Psychologie, Sportpsychologie und Psychotherapie widmet sich Brit Hitzschke der Verknüpfung leistungssportlicher und psychotherapeutischer Expertise. Dabei hat sie sich als Ziel gesteckt dazu beizutragen psychische Beeinträchtigungen und Störungen im Sport zu entstigmatisieren, für schwierige sportspezifische Situationen zu sensibilisieren und Sportlern sportadaptierte Kontakt- und Behandlungsangebote anbieten zu können. Im Gespräch erklärt sie, wann Sport krank machen kann, wie die Behandlung aussieht und warum Sportpsychiatrie auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist.
Sie beschäftigen sich mit Sportlern, die seelisch erkrankt sind. Hat Sport nicht eigentlich eine positive Wirkung auf die seelische Gesundheit?
Das ist richtig, Sport an sich macht nicht krank! Im Gegenteil - gerade im Bereich psychischer Störungen wie Depressionen und Angststörungen sind Sport und Sporttherapie sowohl präventiv, als auch therapeutisch als Monotherapie oder auch als begleitende Therapie sehr wirksam. Neben allgemein bekannten präventiven Effekten zur Verhinderung kardiovaskulärer und zerebrovaskulärer Erkrankungen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Osteoporose, Fettstoffwechselstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen gibt es auch neurobiologische, stimmungsaufhellende Effekte über eine erhöhte Serotonin- und Endorphinausschüttung und auch kognitiver Effekte u.a. über eine Stimulierung der Neurogenese in bestimmten Gehirnarealen und einer Steigerung der synaptischen Plastizität. Wir wissen außerdem, dass Sport den Sympathikotonus verringert und einen cortisolreduzierenden und damit stressreduzierenden Effekt hat. Insgesamt wirkt Sport - wenn man seinen inneren Schweinehund besiegt und es regelmäßig ausführt - antidepressiv, angstlösend, stimmungsverbessernd, stressreduzierend und ist dabei nebenwirkungsarm - also eine ziemlich gute Sache. Sport kann zudem einen starken selbstwirksamkeitssteigernden Effekt haben, wenn man spürt, dass man selber etwas für sein Wohlbefinden tun kann. Das finde ich insbesondere für Patienten mit psychischen Problemen sehr wichtig.
Und wann macht Sport Probleme?
Grob gesagt, wenn die Erholungs- und Beanspruchungsbalance auf mehreren Ebenen über längere Zeit nicht mehr stimmt. Im Profisport gibt es dabei allgemeine Risikofaktoren wie ein hohes Trainingspensum, starker Auswahldruck, eine Überidentifikation mit der Sportleridentität, Existenzängste oder auch medialen Druck. Daneben gefährden Stressoren wie Verletzungssituationen, Übertraining oder Konflikte die seelische Gesundheit. Insbesondere der Faktor der Überidentifikation mit der Sportleridentität ist meiner Meinung nicht zu unterschätzen: So viel potentiell positives Feedback wie im Sport bekommt man im normalen Alltag in der Regel nicht. Mit dem Ausscheiden aus dem Leistungssport geht es dann häufig um Themen wie Perspektiv - und Identitätsentwicklung außerhalb des Sports also darum "was macht mich eigentlich aus außerhalb des Sports und wo will ich hin?", das ist keine leichte Aufgabe. Zudem ist das Thema des richtigen Abtrainierens extrem wichtig für das physische und psychische Befinden.
Aber auch im Alltag und in der Biografie gibt es neben vielen positiven Effekten z.B. auf die Zielorientierung oder das Durchhaltevermögen auch negativ begünstigende Faktoren. Oft beginnen Sportler schon in der Kindheit mit dem Leistungssport und müssen daher die verschiedenen psychosozialen, sportlichen, schulischen und körperlichen Entwicklungsschritte parallel absolvieren und dabei schon früh lernen mit immensem Leistungsdruck umzugehen. Dabei bedarf es dann schon einer sehr guten und umsichtigen Förderung, damit nicht Teile der außersportlichen Entwicklung auf der Strecke bleiben. Ich erlebe in meiner Arbeit da ganz unterschiedliche Bezugssysteme und Trainer mit verschiedenen Qualifikationen, Motivationen und Differenzen im Weitblick, auf die es sich einzustellen geht. Und klar, habe ich auch einige Trainer erlebt, die unzureichend sensibel mit der psychosozialen Entwicklung der Sportler umgegangen sind. So habe ich auch von Trainer mitbekommen, die durch ihre rabiaten Interventionen als großer Auslöser z.B. für Essstörungen bei jungen Sportlerinnen angesehen werden können. Zudem ist es natürlich so, dass aktive Sportler durch den hohen Trainingsumfang, die diversen Wettkämpfe und Trainingslager, sonstigen Termine und Schule oder später vielleicht einem parallelen Job oder Studium extrem ausgeplant sind, was Einschränkungen in der Lebensgestaltung und manchmal auch in der Beziehungswahl mit sich bringt.
Das sind vorrangig Leistungssportprobleme – welche Themen tragen Hobby- oder Breitensportler an Sie heran?
Da Breiten- und Leistungssport oft fließend ineinander übergeht, ist das manchmal schwierig zu differenzieren. Was mich immer wieder verwundert ist, dass die unkontrollierte Einnahme von Anabolika oder Schmerzmitteln ein größeres Problem im Breitensport darstellt als man denken würde -gerade in Anbetracht des Nebenwirkungsprofils. Außerdem ist Sportsucht ein Thema, das auch im Breitensport immer mehr en vogue kommt. Dabei wird das Sporttreiben zur Sucht und es werden systematisch Verletzungen oder Erholungsbedürfnisse missachtet und andere Lebensbereiche vernachlässigt. Problematisch ist hier auch eine hohe Korrelation zu Essstörungen, wo Sport häufig zwanghaft rigide zur Gewichtsreduktion angewandt wird. Und natürlich habe ich auch Anfragen, die in den motivationspsychologischen Bereich gehen im Sinne von "wie überliste ich meinen inneren Schweinehund oder wie kann ich Sport in meinen stressigen Alltag integrieren?".
Gibt es dabei auch sporttypische Persönlichkeitsmerkmale, die psychische Probleme begünstigen?
Ja, gibt es. Begünstigende Persönlichkeitsmerkmale sind zum Beispiel Perfektionismus, zwanghafte und mitunter unkontrollierbare Leidenschaft, hohe Identifikation über den Sport, niedriger Selbstwert und negative Emotionalität. So haben diese Sportler häufig sehr hohe Ansprüche an sich, wollen alles perfekt machen, haben große Versagensängste oder "brennen" so sehr für den Sport, dass sie zu sehr über physische und psychische Grenzen gehen. Im Bereich der Essstörungen ist es zudem z.B. vulnerabilisierend, wenn gewichtsregulierende Maßnahmen schon vor der Menarche begonnen werden und Trainer zur Gewichtsreduktion auffordern. So gibt es Studien, die zeigen, dass dies bei 75% der Athleten zu einer Zuhilfenahme von pathologischen Mitteln zu Gewichtsreduktion führt, was ich sehr bedenklich finde. Wie schon angedeutet kann es eben auch zum Problem werden, wenn sich Sportler zu sehr über ihren Sport identifizieren. Fällt der Sport irgendwann weg, führt dies dann oft zu einer Identitätskrise, die auch mit Anpassungsstörungen, Substanzmissbrauch oder Ängsten in Verbindung stehen kann. Das ist verallgemeinernd vergleichbar mit einem Manager, der aus seinem Job aussteigt oder in Rente geht und sich nicht mehr gebraucht fühlt. Sowohl Sportler als auch ihr Umfeld unterschätzen diese Problematik oft, sodass es in meinen psychotherapeutischen Behandlungen fast immer eine Rolle spielt.
Welche Sportarten sind besonders gefährdet für psychische Krankheiten?
Im Allgemeinen unterscheidet sich die Prävalenzrate neusten Studien zufolge nicht zwischen Leistungssportlern und der Allgemeinbevölkerung. Wenn man genauer hinguckt, gibt es jedoch ein paar Unterschiede, z.B. im Bereich der Essstörungen. So gibt es Risikosportarten, bei denen die Prävalenz sowohl bei Frauen als auch bei Männern deutlich höher ist. Besonders ästhetische Sportarten wie Tanzen, Turnen oder Eiskunstlauf sind häufig von Essstörungen betroffen. Neben oft radikalen Schönheitsidealen beeinflussen dabei auch die komplexen biomechanischen Figuren den Wunsch nach Gewichtsreduktion. So stellt die Pubertät im Paarlauf z.B. eine kritische Periode für die weitere leistungssportliche Entwicklung der Athletinnen dar. Daneben sind auch Gravitationssportarten, Sportarten mit Gewichtsklassen oder Ausdauersportarten betroffen. Dem gegenüber gibt es natürlich auch Sportarten, die ein Zunehmen begünstigen, wie etwa Sumo Ringer oder manche Wurfdisziplinen.
Im Feld der depressiven Erkrankungen sind die Auffälligkeiten schwerer greifbar. Es sind aber eher Individualsportler als Mannschaftssportler betroffen und ähnlich der Allgemeinbevölkerung auch mehr Frauen als Männer. Gerade die Zeitspanne des geplantes oder unfreiwilligen Karriereendes ist eine kritische Phase und führt oft zu psychischen Auffälligkeiten wie Substanzmissbräuchen, (Sport-) Wettsucht, depressiven oder ängstlichen Anpassungsreaktionen. So berichteten laut einer Studie der FIFPRO 40% der ehemaligen Fußballer 5 Jahre nach Karriereende von Ängsten, Depressivität und vermehrtem Alkoholkonsum.
Wie können Sie helfen, wenn ein Sportler zu Ihnen in die Spezialsprechstunde kommt?
Meist gibt es zunächst einen bis zwei niedrigschwellige Kontakte per Email, Telefon oder im persönlichen Gespräch, in dem ich versuche die Probleme zu erfassen, erste diagnostische Einschätzungen zurück zu melden und über die Dimensionalität psychischer Störungen sowie Psychotherapie aufzuklären. Auch eine gemeinsame Fallbesprechung mit den Trainern, Physiotherapeuten und Sportpsychologen kann nach Zustimmung mit dem Sportler dazugehören. Therapeutisch ist der Ansatz dann je nach Störungsbild ganz unterschiedlich: Manchmal helfen drei Stunden, in denen ich den Sportlern einige Tipps, Übungen und Sensibilisierungen vermitteln kann. Manchmal gibt es auch den Bedarf das soziale Umfeld einzubeziehen und zu sensibilisieren. Bei ungefähr der Hälfte meiner Fälle liegt auch eine manifeste psychische Störung vor, die längerfristig behandlungsbedürftig ist. Diese Fälle übernehme ich dann psychotherapeutisch oder vermittele sie innerhalb des Netzwerkes weiter, zu dem auch die Fliedner Klinik Berlin gehört.
Der wesentliche Schritt ist, dass der Sportler oder die Sportlerin rechtzeitig den Kontakt aufnimmt. Oft melden Athleten sich erst, wenn die körperlichen Beschwerden überhand gewinnen.
Warum ist das so?
Psychische Gesundheit im Sport ist noch immer ein Tabuthema. Nach dem Tod von Robert Enke und dem Engagement der Robert-Enke Stiftung ist dies zwar etwas besser geworden, aber von einem offenen und selbstverständlichen Umgang sind wir noch weit entfernt. Das liegt auch daran, dass eine psychische Krankheit im Sport noch oft als Karriereende begriffen wird – das muss aber nicht so sein, wenn man frühzeitig eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung beginnt. So kann ich aus meiner eigenen Praxis auch von Sportlern berichten, die im Laufe der psychotherapeutischen Behandlung wieder mit Leistungssport begonnen haben oder diesen nicht einmal unterbrochen haben. Auch hier hilft ein enger Kontakt zu den Sportmedizinern, Physiotherapeuten oder Sportpsychologen am Olympiastützpunkt oder Verband. Sie sind viel enger an dem System dran und können daher wichtige systemische Infos geben bzw. gute Motivationsarbeit leisten. Ich habe in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen in der Übergabe oder der gemeinsamen Betreuung von Sportlern machen können und finde die Kontakte sehr wesentlich für die Therapieinitiierung. Daher gehört es auch zu meinen Aufgaben, innerhalb dieser Gruppen aufzuklären, zu informieren und zu sensibilisieren.
Was ist in der Behandlung von Sportlern anders als bei anderen Patienten?
Hilfreich ist es im Sportbereich etwas systemischer zu arbeiten und das oft sehr enge Beziehungsnetz zu berücksichtigen. Schwierig ist es, insbesondere bei hauptberuflichen Sportlern, dass sie viel unterwegs sind. Als Therapeutin bedarf es daher einer gewissen Flexibilität in der Terminfindung. Eine Besonderheit ist auch der oft sehr hohe Leistungsanspruch an Psychotherapie, der der therapeutischen Arbeit teilweise widerspricht und blockiert. Nicht zuletzt kann auch Schweigepflicht ein Thema sein, wenn beispielsweise Trainer oder Verbände genau über Therapiefortschritte informiert werden wollen. Die sehr klaren psychotherapeutischen Schweigepflichtrichtlinien sehe ich da als sehr hilfreich an. So kann ich mich bewusst distanzieren und dem Sportler diese Distanz und diesen geschützten Raum ebenfalls zugänglich machen.
Sie waren selber Leistungssportlerin. Was ist Ihr Antrieb für die Arbeit als Psychotherapeutin im Sportkontext?
Meine Arbeit ist geprägt durch die Leidenschaft zum Sport. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das System Sport teilweise skurril aber gleichzeitig faszinierend und unglaublich bereichernd sein kann. Das gilt auch für meine enge Zusammenarbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern. Sie investieren viel Herzblut und Aufwand. Ich finde als Gesellschaft haben wir eine Verpflichtung, diesen Menschen etwas zurück zu geben und sie in schwierigen Zeiten wie Erkrankungen oder dem Karriereende zu unterstützen.
Sportpsychiatrie- und Psychotherapie
Neben Sportpsychologen, die vorranging für die Optimierung von psychischen Leistungsvorraussetzungen zum Abruf der Leistungspotentiale in Trainings- und Wettkampfsituationen zuständig sind, gibt es das Feld der ambulanten und klinischen Sportpsychiatrie und –Psychologie, das sich mit dem Erkennen und Behandeln von psychischen Erkrankungen bei Sportlern beschäftigt. Dieses ist meist mit von Vereinen und Verbänden unabhängigen Psychiatern und Psychotherapeuten besetzt. Sie können die speziellen Umgebungsbedingungen des Sports berücksichtigen und interdisziplinär z.B. mit Sportpsychologen, Sportmedizinern, Physiotherapeuten und Trainern kooperieren und gleichzeitig eine neutrale Anlaufstelle für Sportler darstellen. Dazu bieten sie spezialisierte, niedrigschwellige psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlungsangebote und präventive Untersuchungen an. Auch Präventionsaufgaben können in kooperativer Funktion mit Sportpsychologen in ihren Aufgabenbereich fallen.
Das Referat Sportpsychiatrie und –psychotherapie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN):
Die Zielsetzung des Referates ist die Prävention, Behandlung und Erhaltung der seelischen Gesundheit im Leistungssport sowie die Erforschung und eine bessere Integration der Sport- und Bewegungstherapie in die Behandlung psychischer Erkrankungen. Unter dem Deckmantel der Robert-Enke Stiftung sind aus dem Referat in den letzten Jahren deutschlandweit universitäre Zentren mit sportspezifischen Sprechstunden entstanden. Im Berliner Raum ergänzen die Fliedner Klinik Berlin und das Zentrum für Psychotherapie der Humboldt-Universität seit 2014 die Angebote der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Das Referat ist bestrebt, der Stigmatisierung von Leistungssportlern durch gezielte Information der Öffentlichkeit entgegenzuwirken. Außerdem gehören die Erforschung der Wirksamkeit der Sport- und Bewegungstherapie bei psychisch Kranken sowie deren Implementierung in den klinischen Versorgungsalltag zu den Zielen des DGPPN-Referats.
Zur Person: Dipl.-Psych. Brit Hitzschke
"Ich setze mich für die Entstigmatisierung von psychischen Störungen im Leistungssport ein und habe mich auf die Behandlung von Sportlern mit psychischen Störungen spezialisiert. Ich erlebe diese Aufgabe als herausvordernd aber zugleich unglaublich spannend und bereichernd."
Nach der eigenen leistungssportlichen Laufbahn im Kanu-Rennsport studierte die Junioreneuropameisterin Brit Hitzschke an der Ruhr-Universität Bochum (RUB) Neuropsychologie und Klinische Psychologie und arbeitet seit 2008 im Lehr- und Forschungsbereich Sportpsychologie der RUB. Dort forschte sie zu Beginn zu den Themengebieten Essstörungen im Leistungssport und Mentale Stärke im Sport und promoviert seit 2012 in dem vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Verbundprojekt Regenerationsmanagement im Sport (Regman, www.regman.org). Innerhalb dieses Forschungsprojektes entwickelte sie das Akutmaß und die Kurzskala Erholung und Beanspruchung (Kellmann, Kölling & Hitzschke, 2016). In diversen Forschungspraktika interessierte sie sich zudem für die Effekte von Sporttherapie in der Prävention und Behandlung von psychischen Erkrankungen. Seit 2013 absolviert sie ihre Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin für Einzelpatienten und Gruppen an der Humboldt-Universität zu Berlin, arbeitet in der Fliedner Klinik Berlin als Psychotherapeutin in Ausbildung/Sporttherapeutin und betreut deren sportpsychiatrischen Angebote. Seit 2012 ist sie aktives Mitglied des Referats Sportpsychiatrie der DGGPN und der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie.