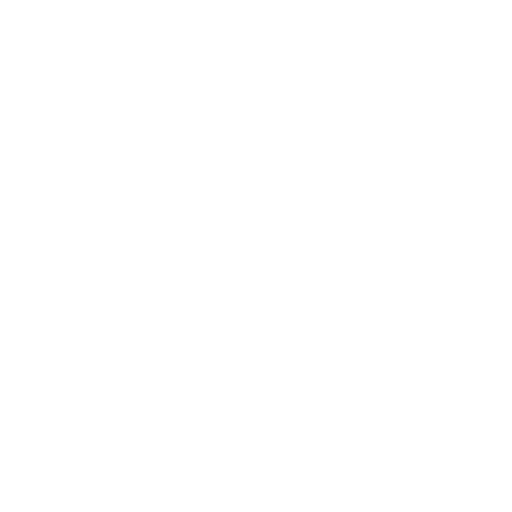Inhalt
Die Patient:innenstory

Tagsüber Projektleiterin, abends Schauspielerin – die gebürtige Hessin Helene H. lebt seit über 30 Jahren in Berlin und liebt die Dynamik der Hauptstadt. Gerne nutzt sie ihr reiches kulturelles Angebot, geht häufig ins Theater oder ins Kino, lässt sich von Menschen, Kultur und Mode inspirieren. Kurzum: Sie fühlt sich wohl inmitten der Metropole, deren Lebendigkeit, Abwechslung und Hektik sie als „Quell der Freude“ empfindet.
Doch seit 2020 und dem Beginn der Coronapandemie ist das anders. Die Laienschauspielgruppe, der Helene angehört, trifft sich derzeit gar nicht oder nur online, Theater und Kinos haben geschlossen, an Ausgehen mit Freunden ist nicht zu denken. Und dazu kommt noch ein persönliches Schicksal, das droht, ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen: Nach 26 Jahren Beziehung verlässt sie ihr Mann. Auch wenn sie bereits vier Jahre zuvor aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, kommt dieser Bruch unvorbereitet und brutal, er trifft sie sehr hart. Helene ist nur noch verzweifelt und traurig, im Stillen fließen die Tränen, sie hat Wutanfälle und kann den Anforderungen ihres Berufes nicht mehr wirklich gerecht werden. Sie reagiert nur noch anstelle zu gestalten, gleicht einer leeren Hülle. „Im Kern konnte ich mich nicht mehr halten, ich konnte mich selbst nicht mehr finden, war mit den Nerven am Ende“, beschreibt sie. In dieser Zeit trinkt Helene sehr viel Alkohol. Auch wenn sie „nie ein Kind von Traurigkeit“ gewesen ist und gerne ausging, hatte sie ihren Alkoholkonsum stets unter Kontrolle - nun nicht mehr. Oft steht sie neben sich, ist unkonzentriert und müde, schläft jedoch nur wenig und schlecht. Eine allgemeine Gleichgültigkeit macht sich breit – ihr ist „alles egal“. Auch verliert Helene ihren Appetit und nimmt stark ab. Das kennt sie bereits aus anderen schwierigen Phasen im Leben, aber es zehrt zusätzlich an ihrer Kraft. So will und kann sie nicht weitermachen und begibt sich im September letzten Jahres in psychotherapeutische Behandlung.
Die Psychotherapeutin kannte sie bereits durch eine dreijährige Behandlung, die sie seit 2013 auf Grund eines Erschöpfungssyndroms begonnen hatte. Die Ehe war schon damals sehr kräftezehrend, die gemeinsame Tochter zog sie fast alleine groß und auch bei der Arbeit war Helene äußerst eingespannt – mehr, mehr, mehr…es wurde einfach zu viel. Nur in der Schauspielerei konnte sie als Ausgleich ihr kreatives Potenzial ausleben und auch Kraft schöpfen. Bis sie 2017 letztlich einen Hörsturz erlitt, den sie dank medizinischer und psychotherapeutischer Behandlung jedoch gut in den Griff bekam.
Als Helene September 2020 ihre Psychotherapeutin um Hilfe bittet, nachdem sie Panikattacken erlitten und weinend aus einem Arbeitsmeeting kam, bietet diese ihr glücklicherweise schnell erneut einen Therapieplatz an. Nach einem halben Jahr rät ihr die Therapeutin zu einer tagesklinischen Behandlung in der Fliedner Klinik Berlin, um die Behandlung zu intensivieren, da sie nochmal „einen zusätzlichen Boost bräuchte“. Nach einem Aufnahmegespräch in der Ambulanz der Fliedner Klinik beginnt Helene im Januar 2021 dann die tagesklinische Behandlung auf Station 3. Erleichtert darüber, „nicht interniert zu sein, irgendwo auf dem Lande“, sondern abends und am Wochenende in ihrer gewohnten Umgebung sein zu können, sieht sie dem Klinikaufenthalt optimistisch entgegen. Auch weiß sie, dass sie etwas tun muss, um ihrer Situation zu entkommen. Sie ist am Ende ihrer Kraft: körperlich, seelisch, geistig. Auch ihre Freunde, die immer zu ihr gehalten haben und sie auch weiterhin unterstützen, bestärken sie in ihrer Entscheidung.
Doch die erste Woche in der Klinik ist schwer, insbesondere „sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, krank ist und sein Leben nicht alleine in den Griff bekommt“. Ihre eigene Situation erschreckt sie, doch Helene macht sich bewusst, dass sie sich auf die Behandlung einlassen muss, um wieder zu sich zu finden.
Dann geht es sehr schnell. Der „begrüßende Umgangston und die sonnige, zugewandte sowie professionelle Atmosphäre“ in der Klinik tun ihr gut. Sowohl mit den Behandler:innen als auch im Beisein ihrer Mitpatient:innen fühlt sie sich zunehmend wohler und profitiert vom respektvollen Austausch. Das Gefühl vermittelt zu bekommen, krank sein „zu dürfen“, und zu akzeptieren, dass sie Hilfe in Anspruch nehmen kann, nehmen eine große Last von ihr.
Gleichzeitig bestärken ihre Behandler:innen sie mit den Worten: „Wir kriegen Sie wieder hin.“ Dass das eigene Leiden ernst genommen wird, gerade wenn man es sich schwer selbst eingestehen kann, Hilfe zu benötigen und auch im familiären Kontext immer wieder das Gefühl hat, sich zusammenreißen zu müssen, ist eine Wohltat. Dabei werden weder Dauer, Stärke noch Gründe für die individuelle Diagnose verglichen -„die Universalität des Leidens“ nennt es eine Therapeutin - die Patient:innen unterstützen sich gegenseitig und nehmen das Leid des anderen ernst. In Loberunden und auch in privaten Gesprächen wird ihr viel positives Feedback zuteil, was ihr dabei hilft, sich wieder besser anzunehmen, sich selbst zu mögen. Im sonnigen Pausenraum, den Helene sehr mag, wird aber auch immer wieder viel gescherzt und Tee getrunken, sogar Schuhe werden gemeinsam geputzt. Es herrscht Leichtigkeit.
Die Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie sagen Helene sehr zu – „die Psychotherapie im Einzelgespräch und die Körperlichkeit, die gelebt wird“, vor allem in Musik- und Sporttherapie, geben ihr dabei viel: „Mit mehreren Menschen zu laufen und sich unterhalten zu können, gerade in Coronazeiten, war so befreiend“ Die gemeinsamen Workouts im Tiergarten mit guten Gesprächen saugt sie auf „wie einen kräftigenden Tee“, und sich im Rahmen der Musiktherapie „mit mehreren Menschen einzugrooven, etwas zu erzeugen, was die Seele berührt, was Freude bereitet und manchmal auch etwas traurig macht“, findet sie sehr schön.
Nun verlässt sie die Klinik und freut sich auf ein „normales Leben“ mit mehr Stabilität, Kreativität und Freude, hat wieder eine Perspektive und geht motiviert zur Arbeit. Sie fühlt sich ausgeruht und gestärkt, ist ihren Behandler:innen sehr dankbar dafür, dass sie ihren Optimismus wiederbekommen hat – daran hatte sie zeitweise nicht mehr geglaubt. Nach wie vor geht Helene regelmäßig zu ihrer Psychotherapeutin, macht weiterhin Yoga und meditiert. „Wenn man sich darauf einlässt, Vertrauen hat und dem positiven Gefühl vom Kollegium traut, was entgegengebracht wird, wird man auch geheilt und bekommt eine neue Lebensperspektive“ resümiert sie ihren Aufenthalt in der Tagesklinik.
März 2021